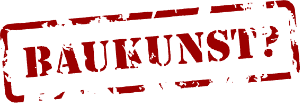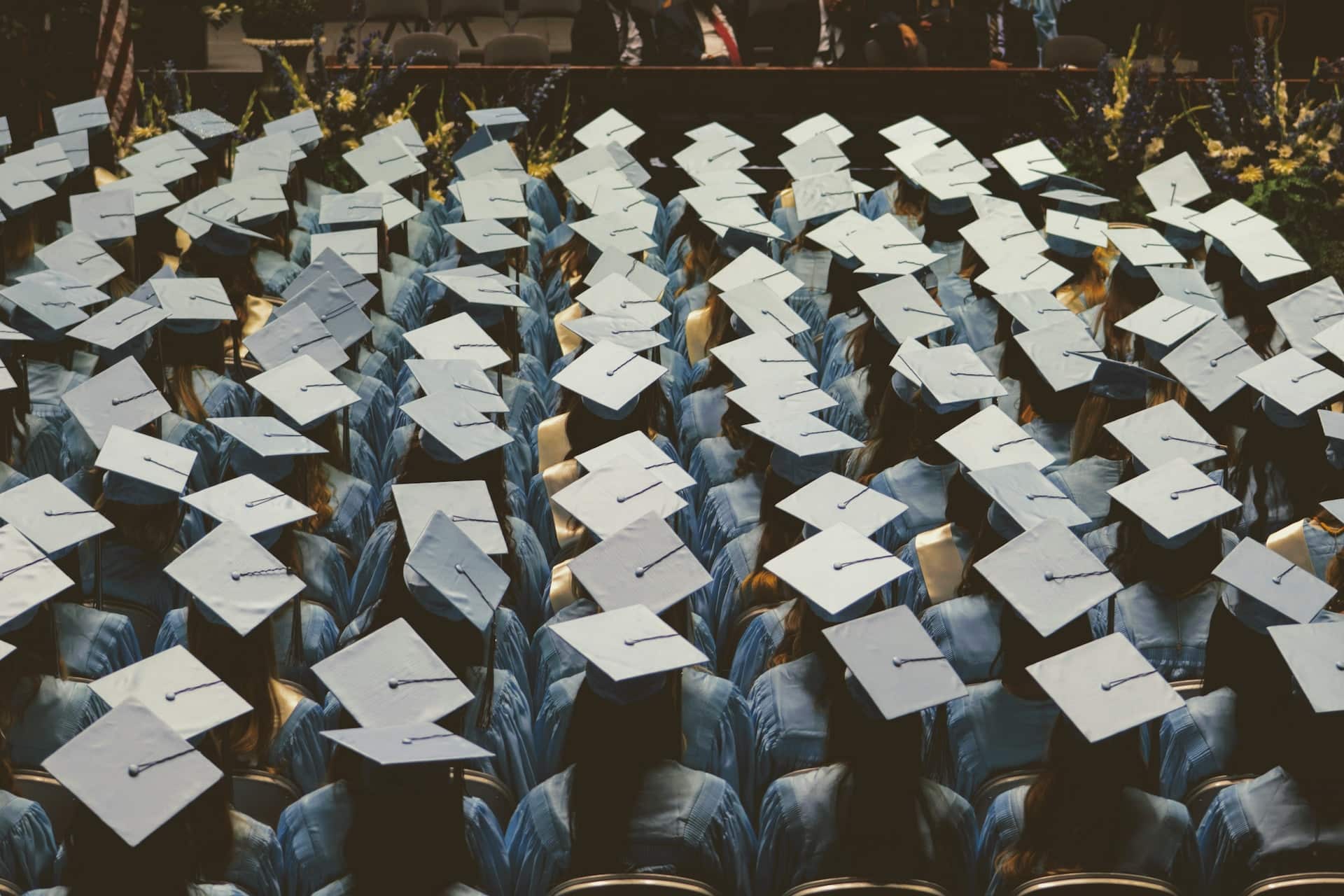Weil am Rhein: Wie eine Grenzstadt zum globalen Architektur-Hotspot wurde – und warum die Shaker-Ausstellung im Vitra Design Museum mehr über regionale Baukultur verrät als erwartet
Wer von Basel kommend über die Grenze nach Weil am Rhein fährt, erlebt einen bemerkenswerten Übergang: Von der schweizerischen Präzision städtebaulicher Ordnung in eine Region, die sich seit drei Jahrzehnten als experimentelles Laboratorium der Architektur neu erfindet. Das Vitra Design Museum und sein Campus sind dabei mehr als nur touristische Leuchttürme – sie sind Katalysatoren einer regionalen Transformation, die weit über die 31.000-Einwohner-Stadt hinausreicht.
Die aktuelle Ausstellung „Die Shaker – Weltenbauer und Gestalter” mag auf den ersten Blick wie ein Fremdkörper in dieser Hightech-Architekturlandschaft wirken. Doch gerade in der Gegenüberstellung offenbart sich eine verblüffende Verwandtschaft zwischen der amerikanischen Glaubensgemeinschaft des 18. Jahrhunderts und der regionalen Baukultur am Oberrhein.
Der Vitra-Effekt: Wie internationale Architektur regionale Identität stiftet
Seit Frank Gehry 1989 sein erstes europäisches Gebäude in Weil am Rhein realisierte, hat sich die Stadt zu einem Mekka der Architekturpilger entwickelt. Zaha Hadid, Tadao Ando, Herzog & de Meuron, SANAA – die Liste der Stararchitektinnen und -architekten liest sich wie ein Who’s who der zeitgenössischen Baukunst. Doch was oft übersehen wird: Diese internationale Strahlkraft hat eine spezifisch regionale Planungskultur befördert.
„Die Präsenz des Vitra Campus hat unsere gesamte Herangehensweise an Stadtentwicklung verändert”, erklärt Diana Stöcker, Oberbürgermeisterin von Weil am Rhein. Die Stadt hat nicht nur eine eigene Gestaltungssatzung entwickelt, die sich an den Qualitätsmaßstäben des Campus orientiert, sondern auch grenzüberschreitende Planungskooperationen mit Basel und Saint-Louis initiiert. Das Dreiländereck wird zunehmend als gemeinsamer Kulturraum begriffen.
Shaker-Prinzipien treffen auf alemannische Handwerkstradition
Die von Mea Hoffmann kuratierte Shaker-Ausstellung offenbart überraschende Parallelen zur regionalen Bautradition. Die radikale Einfachheit der Shaker-Möbel, ihre Verbindung von Funktion und spiritueller Bedeutung, findet ein Echo in der alemannischen Fachwerktradition des Schwarzwalds. Beide Kulturen teilen eine Wertschätzung für ehrliches Handwerk, dauerhafte Materialien und eine Ästhetik, die aus der Notwendigkeit erwächst.
Besonders augenfällig wird dies im benachbarten Schopfheim, wo das Architekturbüro Lederer Ragnarsdóttir Oei mit dem Neubau der Sparkasse eine zeitgenössische Interpretation regionaler Bautraditionen geschaffen hat. Die verwendeten Materialien – heimischer Sandstein, Lärchenholz aus dem Schwarzwald – und die handwerkliche Präzision der Ausführung hätten auch bei den Shakern Anerkennung gefunden.
Nachhaltigkeit als regionales Markenzeichen
Die Shaker-Philosophie des „Wenn wir etwas Gutes gefunden haben, bleiben wir dabei” trifft in der Region auf fruchtbaren Boden. Baden-Württemberg hat mit seiner novellierten Landesbauordnung 2023 die Holzbauoffensive verstärkt und fördert gezielt regionale Wertschöpfungsketten. Im benachbarten Freiburg entsteht mit dem Rathaus im Stühlinger Europas größtes öffentliches Gebäude in Holzbauweise – ein Projekt, das ohne die regionale Expertise im nachhaltigen Bauen undenkbar wäre.
Die Verbindung von technologischer Innovation und traditionellem Handwerk, die die Shaker praktizierten, spiegelt sich auch in der regionalen Wirtschaftsstruktur wider. Mittelständische Unternehmen wie Duravit in Hornberg oder Hansgrohe in Schiltach verbinden globale Designambitionen mit lokaler Fertigungskompetenz.
Kritische Betrachtung: Zwischen Authentizität und Kommerzialisierung
Die Ausstellung thematisiert auch einen Widerspruch, der für die Region symptomatisch ist: Im Vitra-Shop kostet eine simple Shaker-Hakenleiste 335 Euro – ein groteskes Missverhältnis zur asketischen Philosophie der Glaubensgemeinschaft. Diese Kommerzialisierung des Einfachen findet ihre Parallele in der regionalen Entwicklung: Während in Weil am Rhein Architekturikonen entstehen, kämpfen umliegende Gemeinden mit Leerstand und demografischem Wandel.
Die Gentrifizierung des ländlichen Raums durch urbane Eliten, die das „authentische Leben” suchen, ist auch im Markgräflerland spürbar. Historische Winzerhäuser werden zu Luxusrefugien umgebaut, während einheimische Familien sich die Mieten nicht mehr leisten können.
Grenzüberschreitende Perspektiven
Ein besonderer Aspekt der regionalen Entwicklung ist die trinationale Zusammenarbeit. Die IBA Basel 2020 hat gezeigt, wie grenzüberschreitende Planung funktionieren kann. Projekte wie der Rheinuferweg von Basel nach Weil am Rhein oder die gemeinsame Entwicklung des Gebiets „3Land” demonstrieren, dass architektonische Qualität keine nationalen Grenzen kennt.
Die Landesbauordnung Baden-Württemberg ermöglicht seit 2019 explizit die Anerkennung ausländischer Qualifikationen im Bauwesen – eine direkte Reaktion auf die Realitäten der Grenzregion. Schweizer Architekturbüros planen in Deutschland, deutsche Handwerkerinnen arbeiten auf Baustellen in Basel.
Ausblick: Die Region als Experimentierfeld
Die Shaker-Ausstellung endet mit der Frage nach der Zukunft utopischer Gemeinschaften. Für die Region Oberrhein stellt sich eine ähnliche Frage: Kann der Spagat zwischen internationaler Strahlkraft und regionaler Verwurzelung gelingen? Die Anzeichen sind ermutigend. Mit dem geplanten „Campus für Gestaltung” in Weil am Rhein entsteht eine Ausbildungsstätte, die regionale Handwerkstradition mit internationalem Designanspruch verbinden will.
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat zudem ein Förderprogramm für experimentelles Bauen aufgelegt, das explizit regionale Besonderheiten berücksichtigt. Ob Strohballenbau im Schwarzwald oder Lehmbau am Oberrhein – die Vielfalt regionaler Bauweisen wird als Innovationspotenzial begriffen.
Die letzten beiden Shaker in Maine mögen keine Nachfolger finden. Doch ihre Philosophie des einfachen, sinnvollen und schönen Bauens lebt in der Region Oberrhein auf eigentümliche Weise fort – nicht als museale Bewahrung, sondern als lebendige Transformation. Wenn das kein Grund zum Glauben an die Zukunft ist.

Berufspolitisches Versagen? Die Baubranche zwischen Regulierung und Realität

„Das war obszön” – Insider packen über Benkos geheimes Millionen-Penthouse aus