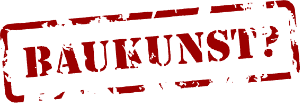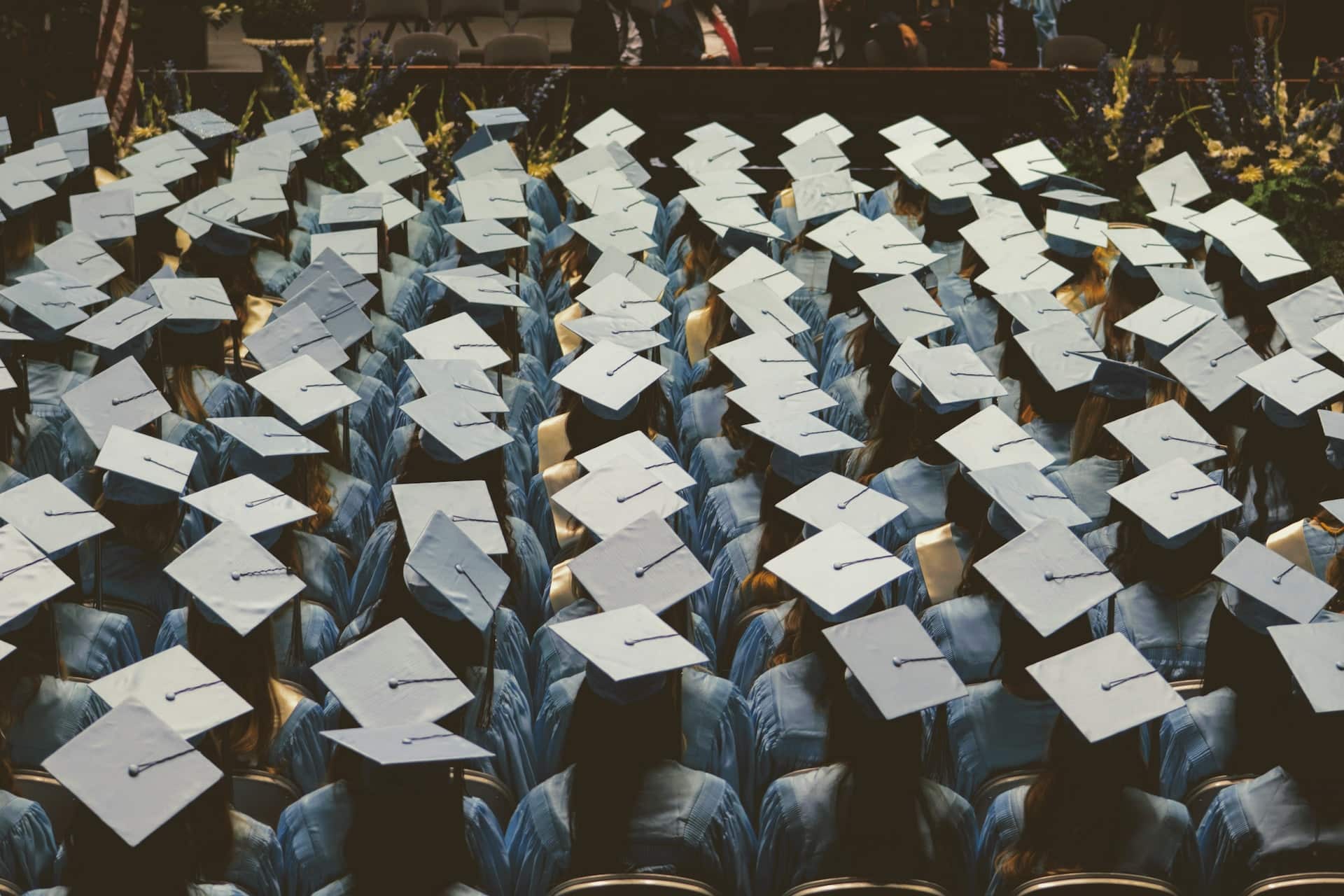Abrisskultur im Wandel: Vom Tabula Rasa zum reflektierten Umgang mit Bestand
Stuttgart als Brennglas einer nationalen Debatte
Die Architekturgalerie am Weißenhof zeigt mit “Abriss 2.0 – umweltgerecht” mehr als eine fotografische Dokumentation. Wilfried Dechaus Vorher-Nachher-Gegenüberstellungen sind ein schmerzhafter Spiegel unserer Baukultur. Was 2016 mit “Stuttgart reißt sich ab” begann, findet nun seine konsequente Fortsetzung – und offenbart dabei einen fundamentalen Wandel im Umgang mit bestehender Bausubstanz.
Graue Energie als neue Währung
Die Zeiten, in denen Architekten und Architektinnen ihre Entwürfe auf der grünen Wiese oder nach Totalabriss planen konnten, neigen sich dem Ende zu. Der Begriff der grauen Energie hat sich vom Nischenbegriff zum zentralen Planungsparameter entwickelt. In Baden-Württemberg, wo die Landesbauordnung bereits verschärfte Anforderungen an den Ressourcenschutz stellt, zeigt sich dieser Paradigmenwechsel besonders deutlich. Ein durchschnittliches Bürogebäude der 1970er Jahre verkörpert etwa 500 bis 800 Kilogramm CO₂-Äquivalent pro Quadratmeter – Energie, die bei einem Abriss unwiederbringlich verloren geht.
Die Stuttgarter Beispiele aus Dechaus Ausstellung illustrieren dieses Dilemma eindrücklich. Wo einst solide Nachkriegsbauten standen, erheben sich heute Neubauten, die zwar energieeffizienter im Betrieb sein mögen, deren Erstellung jedoch Jahrzehnte an CO₂-Einsparungen zunichtemacht. Die Rechnung ist simpel: Ein Neubau muss 50 bis 80 Jahre betrieben werden, um die bei seiner Errichtung verursachten Emissionen durch verbesserte Energieeffizienz zu kompensieren.
Regionale Besonderheiten prägen die Abrisspraxis
Baden-Württemberg steht exemplarisch für ein Bundesland im Spannungsfeld zwischen Wachstumsdruck und Nachhaltigkeitszielen. Die Landeshauptstadt Stuttgart, eingekesselt in ihrer Tallage, kann nicht in die Fläche wachsen. Der Druck auf den Bestand ist enorm. Gleichzeitig hat das Land mit der Novellierung der Landesbauordnung 2023 die Weichen für eine ressourcenschonendere Bauwirtschaft gestellt. Die verpflichtende Prüfung von Umbau- und Sanierungsalternativen vor jedem Abrissantrag ist mehr als eine bürokratische Hürde – sie manifestiert einen Kulturwandel.
Besonders bemerkenswert sind die regionalen Unterschiede in der Umsetzung. Während Freiburg mit seinem “Leitfaden Bauen im Bestand” Vorreiter ist und systematisch Bestandsgebäude auf Transformationspotenziale untersucht, agieren kleinere Kommunen im ländlichen Raum oft noch nach alten Mustern. Die Gründe sind vielschichtig: fehlende Fachkompetenz in den Bauämtern, Investorendruck und nicht zuletzt eine tief verwurzelte Skepsis gegenüber “alter Bausubstanz”.
Handwerk und Industrie in der Transformation
Der Wandel zur Bestandserhaltung fordert das regionale Baugewerbe heraus. Abbruchunternehmen müssen zu Rückbauexperten werden, Handwerkerinnen und Handwerker benötigen Kompetenzen im Umgang mit historischen Baumaterialien und -techniken. In Stuttgart hat sich ein Netzwerk aus spezialisierten Betrieben gebildet, die sich auf die behutsame Demontage und Wiederverwendung von Bauteilen spezialisiert haben. Ein Schreinermeister aus Esslingen berichtet von der Renaissance traditioneller Verbindungstechniken: “Plötzlich ist das Wissen meines Großvaters wieder gefragt.”
Die Baustoffindustrie reagiert mit innovativen Recyclingkonzepten. In Göppingen entsteht derzeit eine Pilotanlage für die sortenreine Trennung von Abbruchmaterialien. Mittels KI-gestützter Bilderkennnung werden Ziegel, Betonteile und sogar Dämmstoffe so aufbereitet, dass sie als hochwertige Sekundärrohstoffe wieder in den Kreislauf gelangen.
Planungskultur im Umbruch
Die Architektenkammer Baden-Württemberg hat die Zeichen der Zeit erkannt. Fort- und Weiterbildungen zum Bauen im Bestand sind ausgebucht, junge Kolleginnen und Kollegen spezialisieren sich auf Bestandstransformation. Ein Stuttgarter Büro hat sich sogar auf “Abrissverhinderung” spezialisiert – sie entwickeln für Eigentümer Konzepte, wie vermeintlich abbruchreife Gebäude wirtschaftlich saniert werden können.
Diese neue Generation von Planern denkt in Lebenszyklen statt in Einzelprojekten. Sie kalkulieren mit CO₂-Budgets wie frühere Generationen mit Kostenrahmen. Ein junger Architekt aus Tübingen formuliert es so: “Für uns ist der kreativste Entwurf der, der mit dem Minimum an neuem Material das Maximum an räumlicher Qualität schafft.”
Förderkulisse als Steuerungsinstrument
Das Land Baden-Württemberg hat seine Förderprogramme konsequent auf Bestandssanierung ausgerichtet. Die “Kombi-Förderung Wohnen und Klima” bevorzugt explizit Sanierungsprojekte gegenüber Neubauten. Kommunen erhalten Zuschüsse für Machbarkeitsstudien zur Bestandstransformation. Diese finanzielle Lenkungswirkung zeigt Erfolge: 2024 wurden erstmals mehr Baugenehmigungen für Sanierungen als für Neubauten nach Abriss erteilt.
Besonders erfolgreich ist das Modellprojekt “Graue Energie sichtbar machen” in Mannheim. Hier müssen Bauherren bei Abrissanträgen eine Ökobilanz vorlegen, die den CO₂-Fußabdruck von Abriss und Neubau dem einer Sanierung gegenüberstellt. Die Transparenz hat zu einem Umdenken geführt – viele Investorinnen und Investoren entscheiden sich nach Kenntnis der Zahlen für den Erhalt.
Konflikte und Widerstände
Der Paradigmenwechsel verläuft nicht konfliktfrei. Bauträger beklagen höhere Planungskosten und längere Genehmigungsverfahren. Mieterinitiativen fürchten Gentrifizierung durch hochwertige Sanierungen. Denkmalschützerinnen und Klimaaktivisten finden sich in ungewohnten Allianzen wieder, während Wohnungsbaugesellschaften vor den Herausforderungen der energetischen Ertüchtigung von Plattenbauten stehen.
Ein Beispiel aus Heilbronn illustriert das Dilemma: Ein Wohnblock aus den 1960er Jahren sollte einer verdichteten Neubebauung weichen. Die Bestandsmieter wehrten sich, Klimaschützer rechneten vor, Investoren drohten mit Rückzug. Am Ende stand ein Kompromiss: Teilerhalt mit Aufstockung, energetische Sanierung und sozialverträgliche Mietgestaltung. Der Prozess dauerte drei Jahre – für alle Beteiligten eine Geduldsprobe.
Ausblick: Die lernende Stadt
Wilfried Dechaus Ausstellung dokumentiert nicht nur vergangene Fehler, sondern weist den Weg in eine reflektiertere Zukunft. Stuttgart, die Stadt, die sich einst selbst abriss, könnte zur Modellstadt für intelligente Bestandsentwicklung werden. Die Werkzeuge sind vorhanden: digitale Gebäudeanalysen ermöglichen präzise Zustandsbewertungen, Building Information Modeling (BIM) erleichtert die Planung im Bestand, zirkuläre Geschäftsmodelle machen Bauteilwiederverwendung wirtschaftlich.
Der kulturelle Wandel ist der entscheidende Faktor. Wenn Baukultur nicht mehr nur das spektakuläre Neue feiert, sondern die intelligente Transformation des Bestehenden würdigt, haben wir einen wichtigen Schritt getan. Die nächste Generation von Architektinnen und Bauherren wird hoffentlich nicht mehr fragen: “Was können wir abreißen?”, sondern: “Was können wir bewahren und verbessern?”
Die Ausstellung am Weißenhof ist mehr als eine Retrospektive – sie ist ein Weckruf und zugleich ein Hoffnungsschimmer. Wenn wir aus den dokumentierten Verlusten lernen, kann aus “Stuttgart reißt sich ab” ein “Stuttgart baut sich um” werden. Die Voraussetzungen dafür sind besser denn je.

Berufspolitisches Versagen? Die Baubranche zwischen Regulierung und Realität

„Das war obszön” – Insider packen über Benkos geheimes Millionen-Penthouse aus