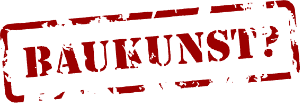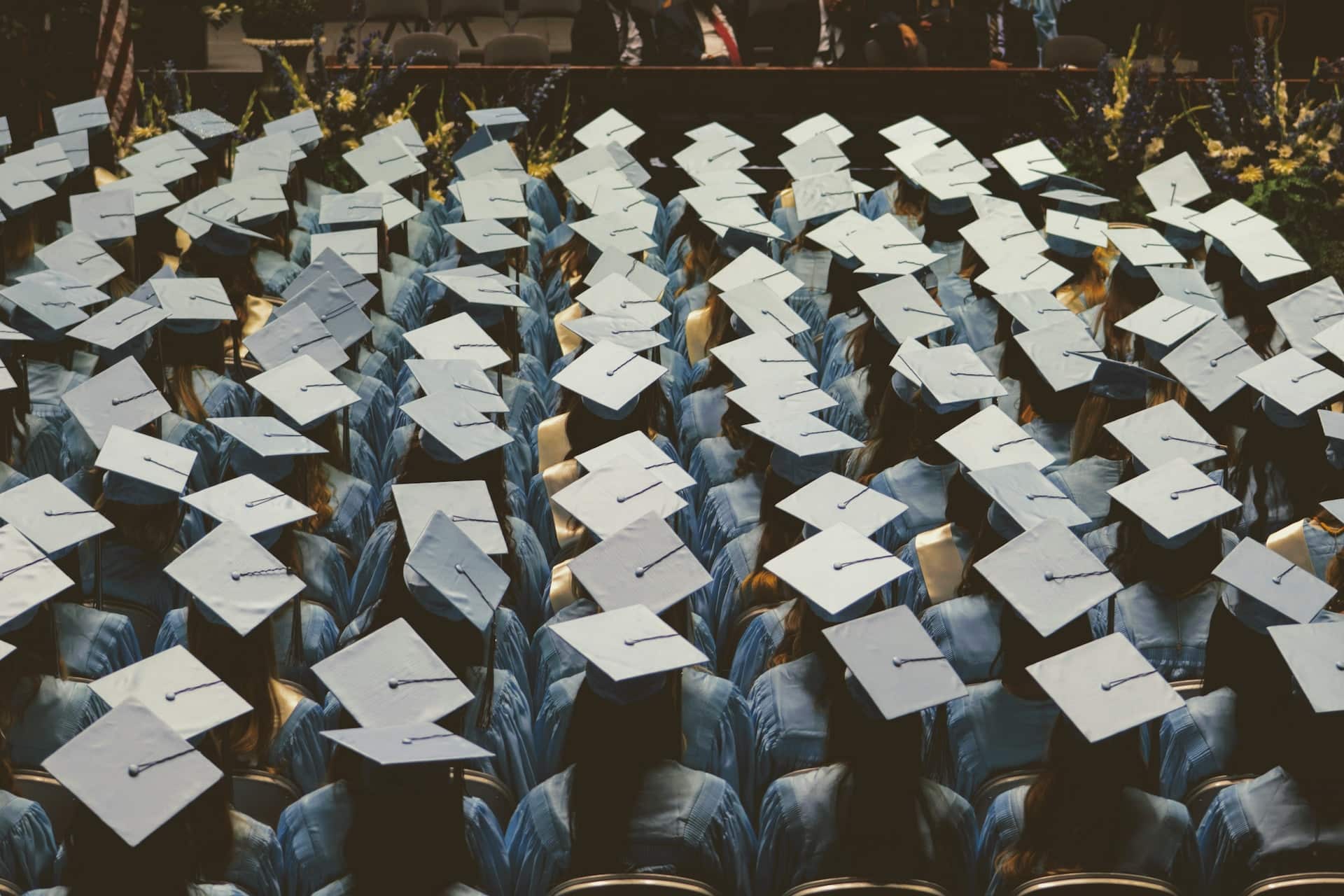Vom Horten-Denkmal zum Bildungspalast
Wenn die Nachnutzung einer Immobilie zur kommunalen Herkulesaufgabe wird
Das „Haus der Neugier” am Aachener Komphausbadstraße wird zur teuersten Wette der Stadtgeschichte: 21,5 Millionen Euro Kaufpreis plus 100 Millionen Euro Umbaukosten für ein leeres Kaufhaus aus den 1970ern.
Das ehemalige Horten-Kaufhaus in Aachen steht stellvertretend für ein Phänomen, das Kommunen bundesweit vor immense Herausforderungen stellt: Wie geht man mit den architektonischen Relikten des Konsumzeitalters um, wenn der Einzelhandel längst abgewandert ist? Die Antwort der Aachener Stadtverwaltung lautet: mit maximalem finanziellen Einsatz und noch größerem politischen Mut.
Ein Denkmal des Wirtschaftswunders wird zum Problemfall
Die charakteristischen Hortenkacheln an der Komphausbadstraße erzählen eine typische deutsche Nachkriegsgeschichte. 1998 aufwendig renoviert, beherbergte das Gebäude nach dem Ende der Horten-Ära das Warenhaus „Lust for Life” – ein durchaus programmatischer Name für einen Ort, der mittlerweile seit Jahren leersteht. Seit 2017 gähnt hier ein architektonisches Vakuum im Herzen der ostrheinischen Universitätsstadt.
Die systematische Verwahrlosung solcher Handelsbauten ist kein Einzelfall, sondern Symptom eines strukturellen Wandels. Während die einen von „Bausünden” sprechen, sehen andere durchaus Potenzial in den robusten Bauvolumen der 1970er Jahre. Die großzügigen Grundflächen und die flexible Raumaufteilung können durchaus als Vorteil für alternative Nutzungskonzepte verstanden werden – vorausgesetzt, man ist bereit, entsprechend zu investieren.
Regionale Besonderheiten in Nordrhein-Westfalen
Die Ausgangslage in Aachen ist exemplarisch für viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen, wo ähnliche Immobilien-Leerstände die Innenstädte prägen. Die Landesbauordnung NRW bietet zwar theoretisch Flexibilität bei Nutzungsänderungen, doch die praktische Umsetzung gestaltet sich oft kompliziert. Besonders bei denkmalgeschützten oder stadtbildprägenden Gebäuden wie dem Horten-Bau entstehen Zielkonflikte zwischen Erhaltung und zeitgemäßer Anpassung.
„Das Gebäude ist nach erster Einschätzung von den vorhandenen Flächen her geeignet, um Volkshochschule und Bibliothek unter einem Dach zusammenzuführen”, analysiert die städtische Verwaltung nüchtern. Diese pragmatische Herangehensweise zeigt, wie Kommunen zunehmend dazu übergehen, leerstehende Handelsimmobilien für öffentliche Zwecke zu aktivieren – ein Trend, der sich in ganz NRW beobachten lässt.
Der Millionenpoker um die Aachener Stadtentwicklung
Aus finanzieller Sicht gerät das Projekt zu einem regelrechten Vabanquespiel. 21,5 Millionen Euro soll die Stadt an die Landmarken AG zahlen – vier Millionen Euro über dem ursprünglich ermittelten Maximalpreis. Hinzu kommen Umbaukosten von geschätzten 100 Millionen Euro und jährliche Folgekosten von 7,7 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der gesamte Kulturhaushalt vieler Großstädte bewegt sich in ähnlichen Dimensionen.
Die politische Debatte offenbart die Spannungen zwischen Zukunftsvision und Haushaltsdisziplin. Während Bürgermeisterin Sibylle Keupen das Projekt als „den ganz großen Wurf” bezeichnet, warnen kritische Stimmen vor einem „Wolkenkuckucksheim”. Die grün-rote Ratsmehrheit setzt bewusst auf eine risikoreiche Strategie: Der Verkauf des Bushof-Gebäudes und des bisherigen Bibliotheksstandorts soll die Finanzierung stabilisieren.
Zwischen Bildungsauftrag und Immobilienspekulation
Das geplante „Haus der Neugier” soll mehr werden als nur die Zusammenlegung von Volkshochschule und Stadtbibliothek. Als „Dritter Ort” konzipiert, verkörpert es einen Ansatz, der in der modernen Stadtentwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnt: öffentliche Räume, die weder Arbeitsplatz noch Zuhause sind, sondern Orte der ungezwungenen Begegnung und des lebenslangen Lernens.
Kritiker monieren jedoch, dass die Stadt sich dabei in eine gefährliche Abhängigkeit begibt. Die Landmarken AG sitzt am längeren Hebel, da Aachen kaum Alternativen für die Unterbringung seiner Bildungseinrichtungen hat. Der Bushof, als zweite Option diskutiert, weist erheblichen Sanierungsbedarf auf. Ein Neubau würde noch mehr kosten und Jahre länger dauern.
Regionale Vorbilder und Warnsignale
Andere Städte in NRW haben ähnliche Projekte bereits umgesetzt – mit gemischten Erfahrungen. In Hamm wurde das dortige Horten-Gebäude bereits 2007 abgerissen und durch das Heinrich-von-Kleist-Forum ersetzt, allerdings zu deutlich geringeren Kosten. In Braunschweig wird noch immer über die Zukunft des dortigen Horten-Baus diskutiert, während in Bremen die städtische Entwicklungsgesellschaft Brestadt das dortige Galeria-Kaufhof-Gebäude erworben hat.
Diese Vergleiche zeigen: Es gibt keinen Königsweg für die Nachnutzung solcher Immobilien. Jede Kommune muss ihre eigene Balance zwischen finanzieller Vorsicht und städtebaulicher Vision finden. Dabei spielen regionale Besonderheiten wie Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftskraft und politische Mehrheitsverhältnisse eine entscheidende Rolle.
Risiko und Chance für die Innenstadtentwicklung
Das Aachener Experiment wird weit über die Stadtgrenzen hinaus beobachtet. Gelingt es, das verwaiste Konsumtempel in einen lebendigen Bildungsort zu verwandeln, könnte dies Modellcharakter für andere Kommunen entwickeln. Scheitert das Projekt jedoch, dürfte es als Warnung vor überambitionierten Immobilienprojekten in die Stadtentwicklungsgeschichte eingehen.
Die demografischen Trends sprechen durchaus für das Konzept: Eine alternde Gesellschaft braucht mehr Orte des lebenslangen Lernens. Gleichzeitig steigt in Hochschulstädten wie Aachen die Nachfrage nach öffentlichen Arbeits- und Begegnungsräumen. Das „Haus der Neugier” könnte diese Bedürfnisse bedienen – wenn die Finanzierung stimmt und das Nutzungskonzept aufgeht.
Entscheidend wird sein, ob es gelingt, das Gebäude nicht nur zu renovieren, sondern zu beleben. Die derzeitige Zwischennutzung unter dem Titel „Lust auf Life” zeigt bereits, dass durchaus Interesse an dem Standort besteht. Ob daraus eine dauerhafte Erfolgsgeschichte wird, entscheidet sich in den kommenden Jahren.
Fazit: Kommunaler Mut oder kostspieliger Irrweg?
Die Entwicklung des Aachener Horten-Gebäudes zeigt exemplarisch, wie schwierig sich die Transformation alter Handelsimmobilien gestaltet. Während private Investoren längst das Weite gesucht haben, sehen sich Kommunen in der Pflicht, städtebauliche Problemfälle zu lösen – oft um jeden Preis.
Das „Haus der Neugier” wird zum Testfall für eine neue Generation kommunaler Großprojekte, die mehr sein wollen als reine Problemlösung. Es soll Impulsgeber für die gesamte Innenstadtentwicklung werden und dabei gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Ob dies gelingt, wird nicht nur die Aachener Stadtentwicklung prägen, sondern auch anderen Kommunen in ähnlichen Situationen als Blaupause oder Warnung dienen.

Berufspolitisches Versagen? Die Baubranche zwischen Regulierung und Realität

„Das war obszön” – Insider packen über Benkos geheimes Millionen-Penthouse aus