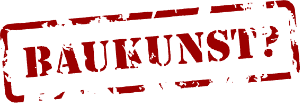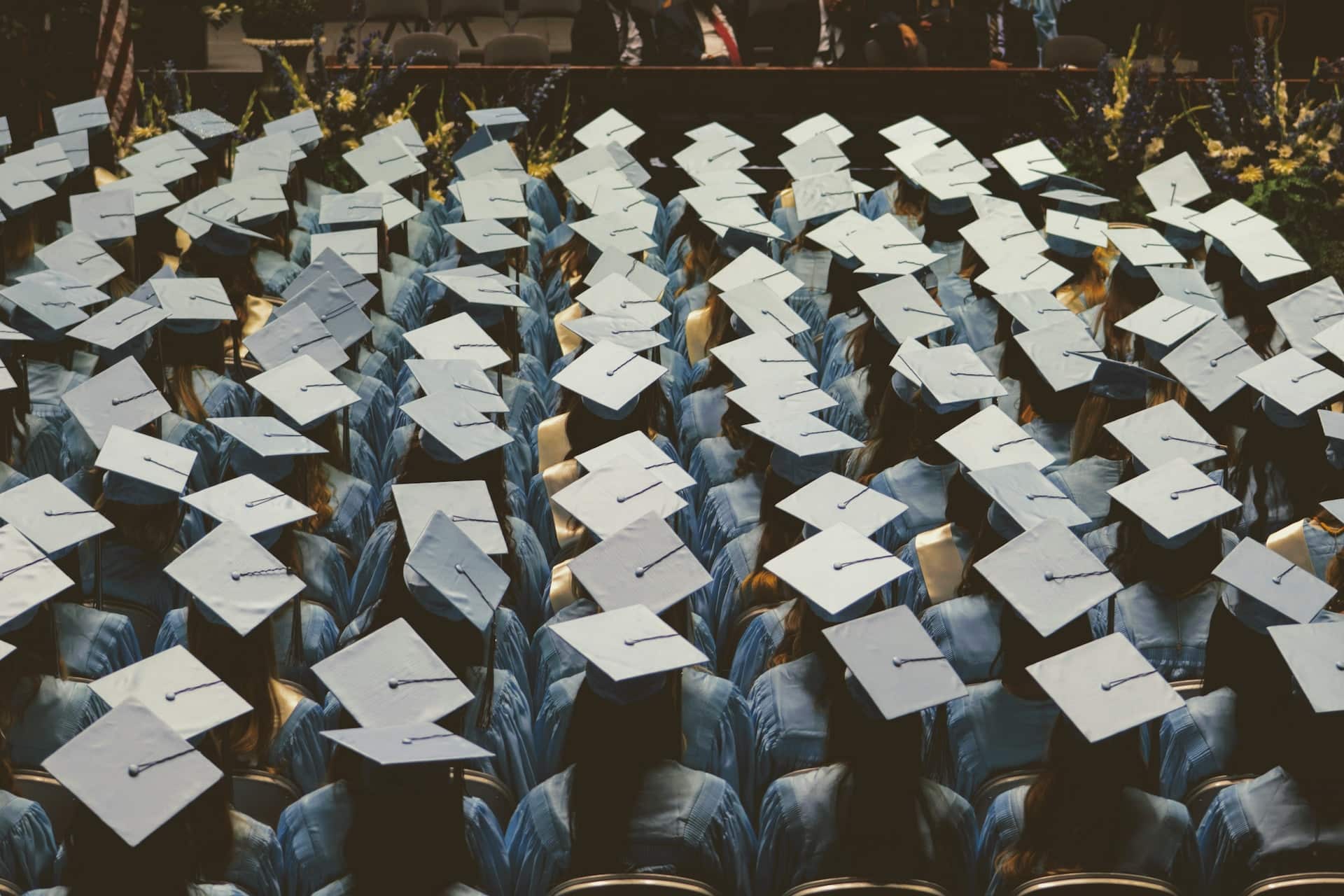Ein 1000-Quadratmeter-Symbol für das Versagen demokratischer Stadtplanung
Die 33. Etage des Upper West am Berliner Zoo – hier manifestiert sich in 1000 Quadratmetern weißem Marmor, was in der deutschen Hauptstadt schiefläuft. René Benkos geheimes Luxuspenthouse, für das er zunächst Star-Architekt Hadi Teherani engagierte und dann fallen ließ, steht exemplarisch für eine Stadtentwicklung, die sich demokratischer Kontrolle entzieht und soziale Spaltung zementiert.
Die Architektur der Abschottung
Panzerscheiben, Privataufzüge, abgeschirmte Zugänge – Benkos Berliner Refugium verkörpert eine neue Dimension urbaner Segregation. Während unten auf der Straße Obdachlose um einen Schlafplatz kämpfen und Durchschnittsverdienende sich keine Wohnung mehr leisten können, entstehen in luftiger Höhe Parallelwelten, die mit dem städtischen Leben nichts mehr gemein haben.
Diese vertikale Gentrifizierung folgt einem globalen Muster: Von Londons „Billionaire’s Row” bis zu New Yorks „Pencil Towers” erobern die Superreichen den Himmel über den Städten. In Berlin, einer Stadt mit eklatanter Wohnungsnot – aktuell fehlen über 240.000 bezahlbare Wohnungen – wirkt ein zweistelliger Millionenbetrag für ein einzelnes Apartment wie ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich mit WG-Zimmern oder überteuerten Einzimmerwohnungen begnügen müssen.
Intransparenz als System
Dass Benkos Penthouse als „Geheimprojekt” bezeichnet wird, offenbart ein grundlegendes Problem moderner Stadtentwicklung: Die Entscheidungen über urbane Räume fallen zunehmend hinter verschlossenen Türen. Während partizipative Planungsprozesse bei öffentlichen Projekten mittlerweile Standard sind, operieren private Investoren in einer Grauzone, die sich bürgerlicher Mitsprache entzieht.
Die Signa-Gruppe nutzte geschickt die Lücken im deutschen Planungsrecht. Solange formale Vorgaben eingehalten werden, können Investorinnen und Investoren nahezu ungehindert agieren. Eine demokratische Debatte darüber, ob Berlin weitere Luxusapartments braucht oder nicht vielmehr sozialen Wohnungsbau, findet nicht statt. Die Stadtgesellschaft wird vor vollendete Tatsachen gestellt.
Der Preis der Exzesse
10.000 Euro pro Quadratmeter – mindestens. Diese Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Für den Preis eines einzigen Quadratmeters in Benkos Penthouse könnte eine vierköpfige Familie ein Jahr lang in einer durchschnittlichen Berliner Mietwohnung leben. Die tatsächlichen Kosten dürften angesichts der beschriebenen Ausstattung – Kino, Gym, Sauna, Dampfbad – noch deutlich höher gelegen haben.
Diese Ressourcenverschwendung hat konkrete gesellschaftliche Auswirkungen. Jeder Euro, der in solche Prestigeobjekte fließt, fehlt für sinnvolle Investitionen in soziale Infrastruktur. Die Baukapazitäten, die für ein einziges Luxuspenthouse gebunden werden, könnten dutzende normale Wohnungen schaffen. In einer Stadt, in der Schulen verfallen und Kitas fehlen, wirkt diese Prioritätensetzung besonders zynisch.
Architekten zwischen Ethos und Kommerz
Die Rolle Hadi Teheranis in dieser Geschichte verdient besondere Betrachtung. Der renommierte Architekt, bekannt für durchdachte Stadtquartiere und nachhaltige Konzepte, ließ sich auf Benkos Geheimprojekt ein – und wurde dann aus Kostengründen fallengelassen. Diese Episode wirft ein Schlaglicht auf die prekäre Position von Architektinnen und Architekten im aktuellen Immobilienmarkt.
Einerseits tragen sie Verantwortung für die gebaute Umwelt und damit für die Lebensqualität aller Stadtbewohnerinnen und -bewohner. Andererseits sind sie wirtschaftlich abhängig von Auftraggebern, deren Interessen oft diametral zum Gemeinwohl stehen. Teheranis Schicksal – erst hofiert, dann fallen gelassen – zeigt, wie wenig Wertschätzung selbst renommierte Planer in diesem System erfahren.
Die Stadt als Spielwiese der Oligarchen
Benkos ehemaliger Vertrauter verglich das Penthouse mit der „Bleibe eines russischen Oligarchen oder saudischen Scheichs”. Dieser Vergleich ist treffender, als es zunächst scheint. Berlin entwickelt sich zunehmend zu einem Tummelplatz internationaler Superreicher, die Immobilien nicht als Wohnraum, sondern als Anlageobjekte betrachten.
Die Folgen dieser Entwicklung sind verheerend: Ganze Stadtteile verlieren ihre soziale Durchmischung, gewachsene Nachbarschaften werden zerstört, lokale Ökonomien verdrängt. Die Stadt wird zur Kulisse für die Selbstinszenierung einer globalen Elite, während die angestammte Bevölkerung an den Rand gedrängt wird.
Wege aus der Krise
Der spektakuläre Zusammenbruch von Benkos Immobilienimperium bietet eine Chance zum Umdenken. Die Politik muss endlich regulierend eingreifen und Luxusprojekte stärker besteuern. Die Einnahmen könnten direkt in den sozialen Wohnungsbau fließen. Städte wie Wien zeigen, dass eine andere Wohnungspolitik möglich ist: Dort leben 60 Prozent der Bevölkerung in geförderten Wohnungen.
Auch das Planungsrecht bedarf einer grundlegenden Reform. Großprojekte ab einer gewissen Größenordnung sollten zwingend öffentlich diskutiert werden müssen. Transparenz muss zur Grundbedingung werden – gerade bei privaten Investments, die das Stadtbild prägen. Die Zeiten, in denen Investoren im Geheimen agieren können, müssen vorbei sein.
Ein Lehrstück für die Zukunft
Benkos „obszönes” Penthouse – so nannten es seine eigenen Vertrauten – steht als Mahnmal einer fehlgeleiteten Stadtentwicklung. Es symbolisiert eine Ära, in der Städte ihre Seele an den Meistbietenden verkauften. Der Fall lehrt uns: Architektur ist niemals neutral. Sie manifestiert gesellschaftliche Verhältnisse in Beton und Glas.
Die Herausforderung für Planerinnen und Planer, für Politik und Zivilgesellschaft besteht darin, Städte wieder als Orte des Gemeinwohls zu begreifen. Orte, an denen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Einkommensklassen zusammenleben können. Orte, die nicht nur den Wenigen, sondern allen gehören. Benkos gescheitertes Imperium mag zusammengebrochen sein – die Aufgabe, lebenswerte Städte für alle zu schaffen, bleibt bestehen.

Berufspolitisches Versagen? Die Baubranche zwischen Regulierung und Realität

„Das war obszön” – Insider packen über Benkos geheimes Millionen-Penthouse aus