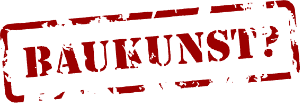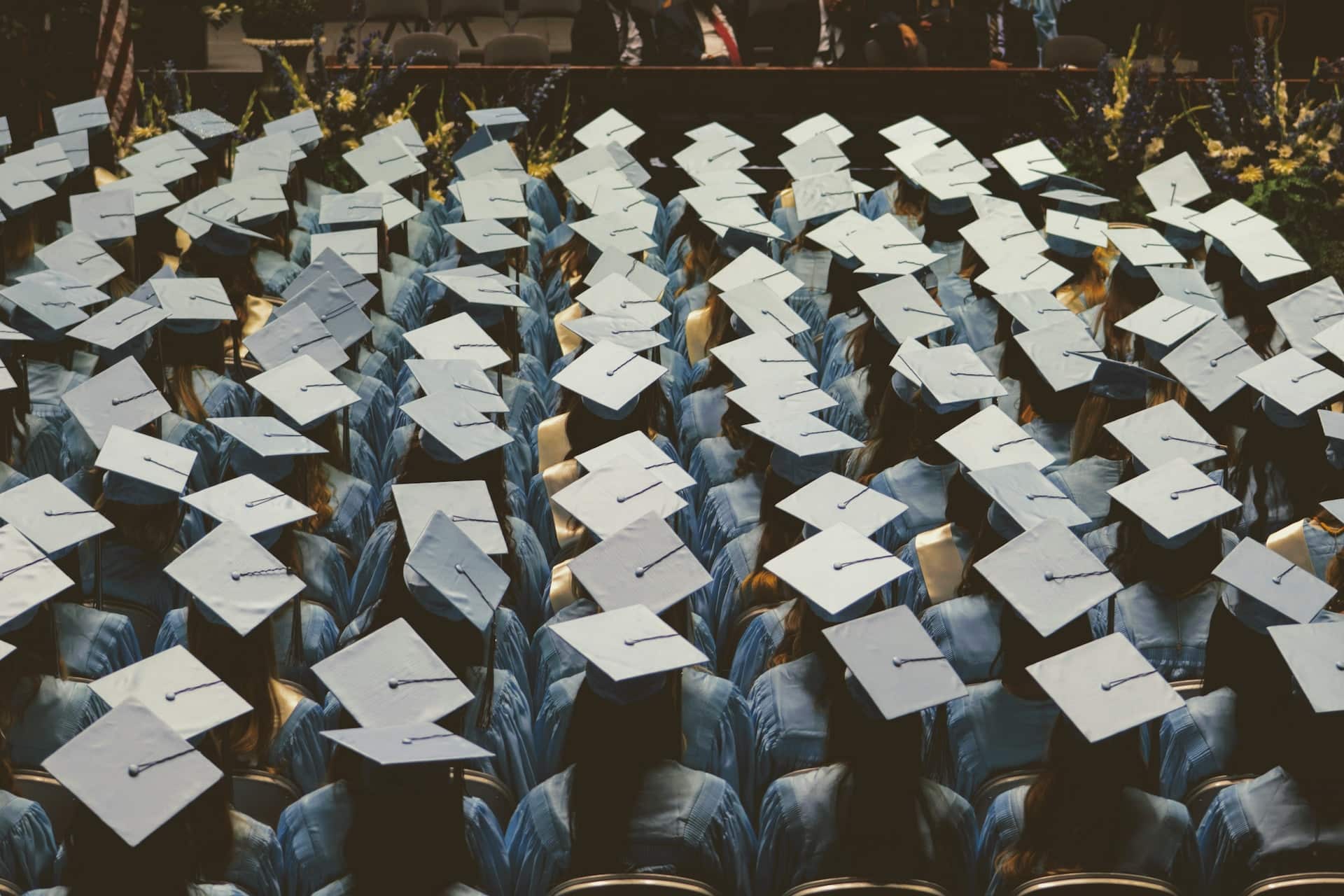NRW-Vergabereform 2026: Freie Fahrt für kommunale Baukultur
Am 9. Juli 2025 läutete der Landtag Nordrhein-Westfalen eine neue Ära der kommunalen Auftragsvergabe ein. Mit der beschlossenen Gesetzesreform, die am 1. Januar 2026 in Kraft tritt, verabschiedet sich das bevölkerungsreichste Bundesland von jahrzehntelangen bürokratischen Fesseln. Für Architektinnen und Planer bedeutet dies nicht weniger als eine Revolution ihrer Akquisemöglichkeiten bei öffentlichen Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte.
Der große Befreiungsschlag
Die Abschaffung des § 26 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW markiert einen Paradigmenwechsel. Bisher zwangen VOB/A und UVgO auch bei kleineren kommunalen Projekten zu aufwendigen Vergabeprozeduren. Diese bundeseinheitlichen Regelwerke gehören im Unterschwellenbereich nun der Vergangenheit an. Stattdessen tritt der neue § 75a der Gemeindeordnung NRW in Kraft – ein schlanker Paragraf, der Kommunen ermächtigt, eigene Spielregeln zu definieren.
Die Reform folgt der lange geforderten Entbürokratisierung des Unterschwellenbereichs. Ziel ist es, den Aufwand für kleinere Aufträge zu reduzieren und den Kommunen mehr Handlungsfreiheit zu geben. Die kompletten vergaberechtlichen Bindungen entfallen – Kommunen können künftig im Unterschwellenbereich direkt Aufträge erteilen.
Schweizer Vorbild: Qualität vor Preis
Die Reform orientiert sich am helvetischen Modell, wo nicht automatisch das billigste Angebot den Zuschlag erhält. Das wirtschaftlichste Konzept macht das Rennen – ein fundamentaler Unterschied, der gerade für qualitätsorientierte Büros neue Perspektiven eröffnet. Nachhaltigkeit, Lebenszykluskosten, gestalterische Exzellenz: All diese Kriterien dürfen künftig stärker gewichtet werden als der reine Angebotspreis.
Die Schwellenwerte bleiben unverändert: Bei Bauleistungen liegt die Grenze bei 5.538.000 Euro, bei Planungsleistungen als Dienstleistungen bei 221.000 Euro netto. Darunter herrscht ab 2026 kommunale Gestaltungsfreiheit.
Persönliche Akquise wird zur Schlüsselkompetenz
Die klare Empfehlung aus Fachkreisen lautet: Direkter Kontakt zu kommunalen Entscheidungsträgern wird essenziell. Diese bewährte Vertriebsstrategie erlebt eine Renaissance. Persönliche Vorstellung bei Baudezernentinnen und Amtsleitern, direkte Präsentation der Bürostärken, informelle Gespräche über anstehende Projekte – all das wird nicht nur möglich, sondern notwendig für den Erfolg.
Planungsbüros sollten in den aktiven Vertriebsmodus wechseln und den Auftraggebern ihre Stärken direkt vermitteln. Eine gut vorbereitete Präsentation, der persönliche Besuch vor Ort und die direkte Vorstellung der eigenen Kompetenzen werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren. Gerade kleine und mittlere Büros, die bisher im formalisierten Vergabedschungel oft untergingen, wittern ihre Chance.
Flickenteppich statt Einheitsbrei
Doch die neue Freiheit hat ihren Preis: Jede der 396 Kommunen in NRW kann künftig eigene Vergabesatzungen erlassen. Was in Düsseldorf gilt, muss in Dortmund noch lange nicht Standard sein. Dieser regulatorische Flickenteppich erfordert von Planungsbüros erhöhte Aufmerksamkeit und Flexibilität.
Die Verunsicherung auf kommunaler Seite ist spürbar. Jahrzehntelang gewohnt, nach starren Regeln zu vergeben, müssen Verwaltungen nun eigene Wege finden. Die Sorge vor Kontrollverlust, wenn Fachbereiche ohne zentrale Vergabestelle agieren, ist berechtigt. Gleichzeitig wächst das Risiko von Intransparenz und – im schlimmsten Fall – Korruption.
Compliance wird zur Chefsache
Experten warnen eindringlich: Wenn persönliche Nähe wieder zum entscheidenden Faktor wird, entsteht das Risiko von Intransparenz und unlauteren Absprachen. Die Lösung liegt in robusten internen Compliance-Strukturen. Kommunen werden Mechanismen entwickeln müssen, die faire Vergaben sicherstellen: Rotation bei Beauftragungen, transparente Eignungsdokumentation, nachvollziehbare Entscheidungsprozesse.
Es ist zu erwarten, dass Kommunen interne Vorgaben im Sinne von Compliance und Prävention erlassen werden – etwa die Regel, nicht immer denselben Planer zu beauftragen, Inhalte zu variieren und die Eignung sorgfältig zu dokumentieren. Auch ohne formales Vergaberecht bestehen gewisse Vorgaben, insbesondere zur wirtschaftlichen und wettbewerblichen Fairness.
NRW als Magnet für Planungsbüros
Die Reform positioniert Nordrhein-Westfalen als Vorreiter der Vergabemodernisierung. Fachleute prognostizieren eine Verlagerung von Vergabevolumina ins bevölkerungsreichste Bundesland. Gezielte Förderprogramme, erhebliche Sondervermögen für Infrastruktur und die schiere Anzahl der Kommunen machen NRW zum Hotspot öffentlicher Bauinvestitionen.
Dabei müssen interessierte Büros keineswegs eine Niederlassung zwischen Rhein und Ruhr gründen. Überregionale Partnerschaften bleiben ausdrücklich möglich. Sollten einzelne Kommunen lokale Präsenz fordern, genügt die Kooperation mit einem ortsansässigen Partner.
Kritische Stimmen aus den Kammern
Die Architektenkammer NRW und die Ingenieurkammer-Bau NRW begrüßen grundsätzlich den Bürokratieabbau. Ihre Sorge gilt jedoch dem möglichen Preisdumping bei Planungsleistungen. Der Grundsatz „Wer billig plant, baut teuer” droht in der neuen Vergabefreiheit unterzugehen.
Diese Befürchtung ist nicht unbegründet. Gerade finanzschwache Kommunen könnten versucht sein, bei knappen Budgets doch wieder primär auf den Preis zu schauen. Hier sind die Berufsverbände gefordert, Aufklärungsarbeit zu leisten und die Bedeutung qualitätvoller Planung für nachhaltige Baukultur zu betonen.
Chancen für mutige Büros
Die NRW-Vergabereform öffnet ein Fenster für innovative Planungsansätze. Wer bisher an starren Ausschreibungskriterien scheiterte, erhält eine zweite Chance. Experimentelle Nachhaltigkeitskonzepte, unkonventionelle Partizipationsmodelle oder radikal nutzerorientierte Entwürfe finden möglicherweise eher Gehör, wenn sie direkt präsentiert werden können.
Gleichzeitig wächst die Verantwortung der Planenden. Ohne formalisierte Verfahren als Schutzschild müssen Büros ihre Professionalität durch eigene Standards unter Beweis stellen. Transparente Honorarkalkulationen, nachvollziehbare Planungsprozesse und belastbare Qualitätssicherung werden zu Wettbewerbsvorteilen.
Ausblick: Evolution statt Revolution
Die Reform ist kein Freibrief für Wildwest-Methoden im Vergabewesen. Vielmehr markiert sie den Beginn einer Evolution hin zu partnerschaftlicheren, flexibleren Formen der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Planenden. Der Erfolg wird davon abhängen, ob beide Seiten die neue Freiheit verantwortungsvoll nutzen.
Für Architektinnen und Planer gilt: Die Zeit des passiven Wartens auf Ausschreibungen endet. Aktive Marktbearbeitung, regionale Vernetzung und überzeugende Qualitätsargumentation werden zu Schlüsselkompetenzen. Wer diese Herausforderung annimmt, dem eröffnen sich in Nordrhein-Westfalen ab 2026 völlig neue Perspektiven.

Berufspolitisches Versagen? Die Baubranche zwischen Regulierung und Realität

„Das war obszön” – Insider packen über Benkos geheimes Millionen-Penthouse aus