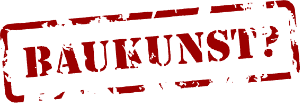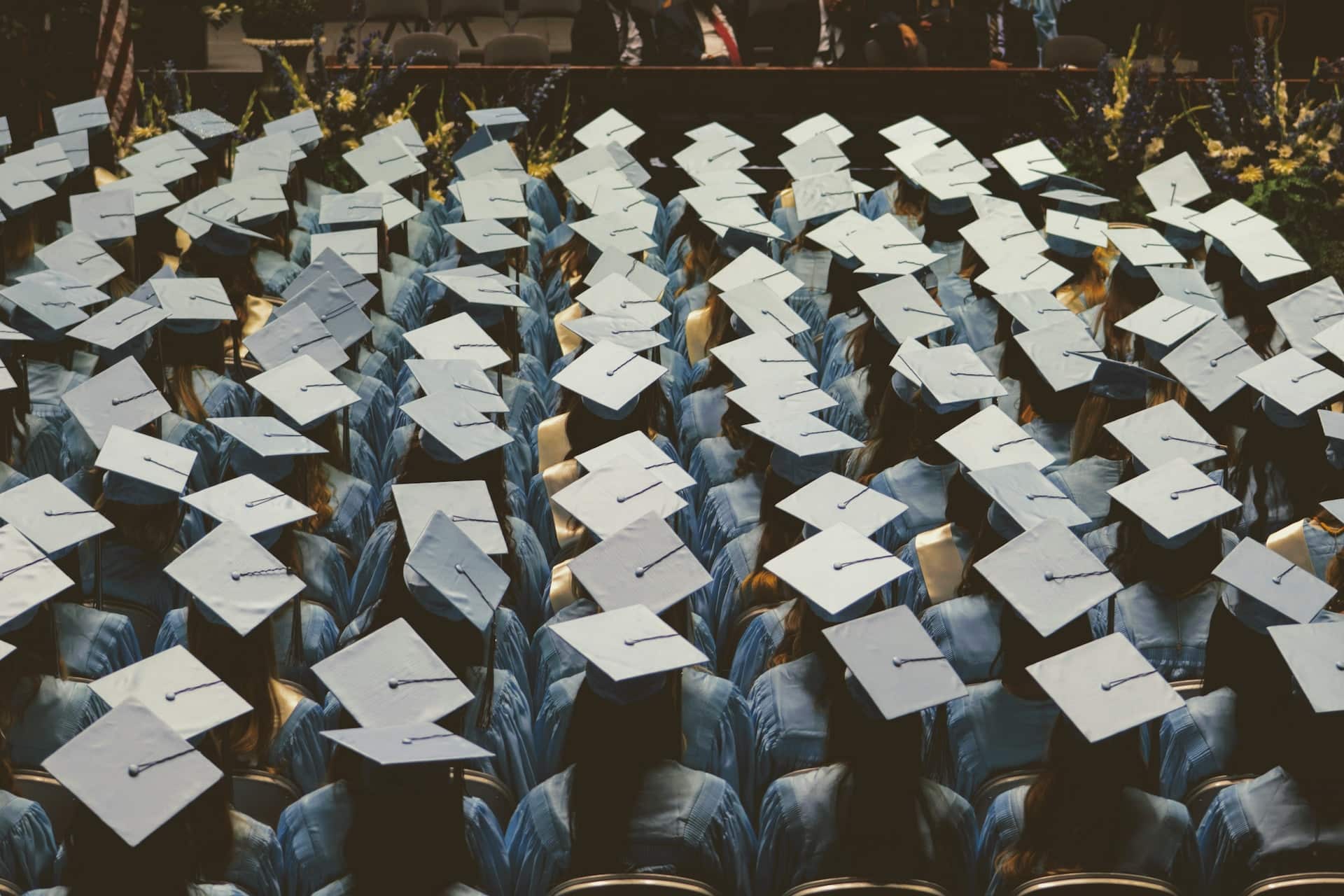Niedersachsens Architektur-Experiment: Das Phaeno als regionale Wegmarke
Zwanzig Jahre nach seiner Eröffnung zeigt das Phaeno in Wolfsburg, wie radikale Architektur eine ganze Region prägen kann. Ein Rückblick auf Zaha Hadids niedersächsisches Vermächtnis und seine Bedeutung für die heutige Baukultur.
Der Experimentiercharakter im Beton
Das Phaeno Science Center in Wolfsburg war 2005 das erste Wissenschaftsmuseum seiner Art in Deutschland. Zaha Hadid beschrieb es als “die ehrgeizigste und vollständigste Aussage unserer Suche nach komplexen, dynamischen und fließenden Räumen”. Was damals als architektonisches Wagnis galt, ist heute zu einem Maßstab für Niedersachsens Umgang mit experimenteller Baukultur geworden.
Mit 27.000 Kubikmetern Beton und zehn konischen Stützen schuf Hadid einen 170 Meter langen und 16 Meter hohen Baukörper, der trotz seiner Masse den Eindruck des Schwebens vermittelt. Diese paradoxe Leichtigkeit prägte nicht nur das Stadtbild Wolfsburgs, sondern auch die architektonische Diskussion in ganz Niedersachsen.
Regionale Baukultur zwischen Tradition und Innovation
Die niedersächsische Architekturlandschaft war lange von pragmatischen Lösungen und regionalen Traditionen geprägt. Das Phaeno durchbrach diese Kontinuität bewusst. Als Teil einer Reihe kultureller Bauten von Aalto, Scharoun und Schweger sollte es Wolfsburg vom reinen Industriestandort zu einem kulturellen Zentrum transformieren.
Diese Strategie spiegelt eine landesweite Entwicklung wider. Der alle zwei Jahre vergebene Niedersächsische Staatspreis für Architektur dokumentiert systematisch die Qualität regionalen Bauens. 2024 stand das Thema “Nachhaltiges Bauen für Wirtschaft und Arbeit” im Fokus. Projekte wie das preisgekrönte CIC in Osnabrück oder das Sartorius-Forschungsgebäude in Göttingen zeigen, wie sich die Region heute zwischen Innovation und Verantwortung positioniert.
Konstruktive Herausforderungen als Lernfeld
Die Realisierung des Phaeno wurde selbst zur “Experimentierlandschaft”: Probleme bei der Betonzusammensetzung erforderten umfangreiche Sanierungen. Viele Quadratmeter tragender Wände mussten durch neuen Beton ersetzt werden. Diese bautechnischen Schwierigkeiten kosteten die Stadt Wolfsburg zusätzliche Millionen, lehrten aber auch wichtige Lektionen.
Heute profitiert Niedersachsen von diesen Erfahrungen. Die Verwendung von selbstverdichtendem Beton und speziell entwickelten Glasfassaden am Phaeno erprobte Technologien, die mittlerweile Standard sind. Die Architektenkammer Niedersachsen integriert diese Erkenntnisse in ihre Fortbildungsprogramme und fördert den Wissenstransfer zwischen den Planenden.
Regionale Netzwerke und Planungskultur
Das seit 2007 jährlich stattfindende Symposium zur Baukultur in Niedersachsen behandelt wechselnde Schwerpunkte. 2024 stand “Second Life – Umnutzen und Weiterbauen im Bestand” im Mittelpunkt. Diese Themenwahl zeigt, wie die Region aus den Erfahrungen mit Großprojekten wie dem Phaeno gelernt hat.
Die niedersächsische Baukultur entwickelt sich heute verstärkt in Richtung Bestandserhaltung und nachhaltiger Transformation. Der Tag der Architektur 2025 steht unter dem Motto “Vielfalt bauen” und präsentiert am 29. Juni 101 Objekte in Bremen und Niedersachsen. Viele davon sind Umbauten und Sanierungen – ein deutlicher Wandel gegenüber der Neubau-Euphorie der 2000er Jahre.
Zwischen Bürgerwille und Architekturanspruch
Teile der Wolfsburger Bürgerschaft kritisieren bis heute die “Öde der Betonlandschaft” und die hohen Sanierungskosten. Allein die Aufbringung des Naturstein-Granulat-Belags kostete 3,5 Millionen Euro. Diese Diskussion ist symptomatisch für ein regionales Spannungsfeld zwischen architektonischem Anspruch und bürgernäher Baukultur.
Niedersachsen hat daraus Konsequenzen gezogen. Das Land fördert heute gezielt Projekte zur Weiterentwicklung der regionalen Baukultur mit einer Anteilsfinanzierung. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf partizipativen Planungsprozessen und der Vermittlung zwischen Fachöffentlichkeit und Bürgern.
Klimawandel und regionale Anpassungsstrategien
Die Erfahrungen mit dem Phaeno fließen heute in die Klimaanpassungsstrategie Niedersachsens ein. Die Architektenkammer thematisiert in ihren aktuellen Fortbildungen die PV-Pflicht auf Dächern und die Notwendigkeit, Städte widerstandsfähiger gegenüber Hitze zu gestalten.
Das Sartorius-Gebäude in Göttingen mit seinem Geothermiefeld und der Holzhybridbauweise zeigt exemplarisch, wie niedersächsische Architekten heute nachhaltige Technologien integrieren. Der Weg führt von der spektakulären Einzellösung zur systematischen Transformation der gesamten Baukultur.
Transfer und Modellcharakter
Das Phaeno zieht Besucher aus einem Radius von 150 Kilometern an, etwa 90 Prozent kommen aus diesem Umkreis. Diese regionale Ausstrahlung macht es zu einem wichtigen Referenzpunkt für die norddeutsche Architekturlandschaft. Der Bau erhielt 2006 sowohl den RIBA European Award als auch den Institution of Structural Engineers Award.
Heute dient das Phaeno als Katalysator für eine neue Generation regionaler Architekten und Architektinnen. Viele der beim Staatspreis prämierten Projekte zeigen deutliche Einflüsse der Hadid’schen Formensprache, übersetzen diese aber in zeitgemäße, nachhaltige Konzepte.
Ausblick: Regionale Baukultur im Wandel
Zwanzig Jahre nach dem Phaeno steht Niedersachsen vor neuen Herausforderungen. Der aktuelle Staatspreis würdigt Projekte, die “soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte über den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen”. Dies markiert eine deutliche Verschiebung von der formalen Innovation zur systemischen Verantwortung.
Das Phaeno bleibt dabei wichtiger Bezugspunkt: nicht als nachzuahmendes Modell, sondern als Erinnerung daran, dass Architektur gesellschaftliche Debatten auslösen und regionale Entwicklungen prägen kann. Die niedersächsische Baukultur hat gelernt, experimentelle Ansätze mit regionalem Verantwortungsbewusstsein zu verbinden.

Berufspolitisches Versagen? Die Baubranche zwischen Regulierung und Realität

„Das war obszön” – Insider packen über Benkos geheimes Millionen-Penthouse aus