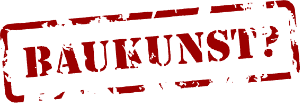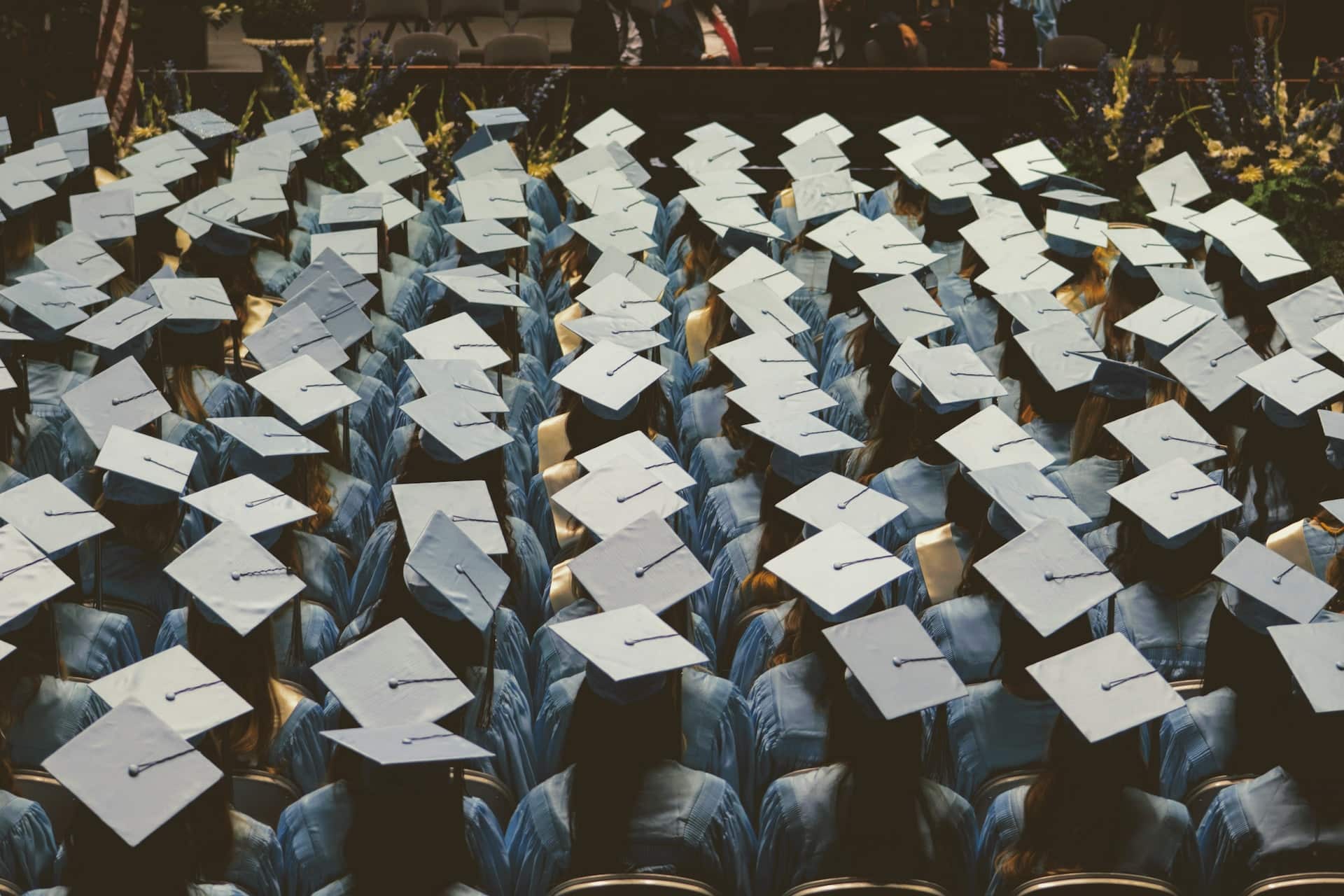Verzauberte Räume in verzaubernden Räumen
Der Genius Loci als perfekter Gastgeber
Es gibt Momente in der Museumsarchitektur, in denen sich Raum und Kunst zu einer symbiotischen Einheit verbinden. Das Städtische Museum Braunschweig am Löwenwall schafft für die aktuelle Ausstellung “Paul Eliasberg: Verzauberte Räume” genau solch einen magischen Moment. Wenn die filigranen Kathedralzeichnungen des deutsch-französischen Künstlers im imposanten Lichthof des Jugendstilbaus von Max Osterloh ihre Wirkung entfalten, verschmelzen zwei Raumkonzepte zu einer faszinierenden Gesamterfahrung.
Osterloh trifft Eliasberg: Ein architektonischer Dialog über die Jahrhunderte
Der zwischen 1904 und 1906 errichtete Museumsbau verkörpert die ambitionierte Bürgerstolzheit des wilhelminischen Braunschweig. Max Osterloh, damals Stadtbaudirektor, schuf mit seinem Entwurf einen klassischen Jugendstilbau, der florale Ornamente und geschwungene Linien mit neobarocken Elementen zu einer eigenständigen Formensprache vereint. Das architektonische Herzstück bildet zweifellos der 18 Meter hohe Lichthof mit seinen historisierenden Wandmalereien zur Stadtgeschichte – ein Raum, der in seiner vertikalen Dramatik durchaus sakrale Qualitäten besitzt.
Paul Eliasberg (1907-1983), der ab dem 1. Juli seine “Verzauberten Räume” hier präsentiert, hätte sich keinen passenderen Ort wünschen können. Seine mit haarfeiner Linie gezeichneten und radierten gotischen Kathedralen finden in Osterlohs Architektur einen kongenialen Partner. Die komplexe, feingliedrige Architektur seiner Kirchenräume korrespondiert mit den Rundbögen und der lichtdurchfluteten Raumfolge des Museums. Es entsteht ein Dialog zwischen gebauter und gezeichneter Architektur, zwischen realem und imaginiertem Raum.
Regionale Verankerung mit internationalem Anspruch
Das Städtische Museum Braunschweig demonstriert mit dieser Ausstellung eindrucksvoll seine Bedeutung als kultureller Leuchtturm in der niedersächsischen Museumslandschaft. Als eine der größten kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen Deutschlands mit über 270.000 Objekten versteht es die 1861 als bürgerliche Stiftung gegründete Institution meisterhaft, regionale Verwurzelung mit internationalem Anspruch zu verbinden.
Die großzügige Schenkung von Danielle Eliasberg, der in Paris lebenden Tochter des Künstlers, unterstreicht die überregionale Strahlkraft des Hauses. Dass ein Museum in einer Stadt von der Größe Braunschweigs solche bedeutenden Nachlässe anzieht, spricht für die Qualität der kuratorischen Arbeit und die Reputation der Institution weit über Niedersachsens Grenzen hinaus.
Zwischen Tradition und Transformation
Besonders bemerkenswert ist die Geschichte des Museumsgebäudes selbst, die exemplarisch für den Umgang mit historischer Bausubstanz in Deutschland steht. Die radikalen Eingriffe der 1970er Jahre unter den Architekten Heinz Röcke und Klaus Renner – die Unterteilung des Lichthofs in mehrere Ebenen, die Verlegung des Eingangs, die Neutralisierung der Farbigkeit – zeugten von einem Zeitgeist, der Funktionalität über historische Substanz stellte.
Die zwischen 2008 und 2012 durchgeführte Sanierung durch den Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Braunschweig markiert einen Paradigmenwechsel im denkmalpflegerischen Bewusstsein. Mit einem Investitionsvolumen von 8,2 Millionen Euro, davon 1,8 Millionen aus EFRE-Mitteln, wurde Osterlohs Vision wiederhergestellt: Der Lichthof erstrahlt wieder in seiner ursprünglichen Höhe, die mutigen Farben – Graublau, Moosgrün und Dunkelrot – wurden rekonstruiert, der repräsentative Eingang mit Freitreppe kehrt an den Löwenwall zurück.
Lebendige Kulturvermittlung statt musealer Erstarrung
Die Kooperation mit der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig im Rahmen der Eliasberg-Ausstellung zeigt, wie zeitgemäße Museumsarbeit funktioniert. Studierende interpretieren die Bildschöpfungen neu und setzen sie in Dialog mit der Gegenwartskunst – eine Form der Kulturvermittlung, die weit über klassische Präsentationsformen hinausgeht. Diese Vernetzung zwischen etablierter Kulturinstitution und Ausbildungsstätte ist charakteristisch für die Braunschweiger Kulturlandschaft, in der die HBK seit ihrer Gründung als Werkkunstschule eine zentrale Rolle spielt.
Architektur als Ermöglichungsraum
Die etwa 70 Werke umfassende Schau profitiert enorm von der räumlichen Qualität des Hauses am Löwenwall. Die variablen Lichtschienensysteme, der helle Stabparkettboden und die differenzierte Farbgestaltung schaffen ideale Präsentationsbedingungen. Eliasbergs unwirkliche, schwebende Perspektiven seiner griechischen Landschaften und sakralen Räume entfalten in diesem Ambiente eine besondere Intensität.
Der Vergleich mit Paul Klee und Lyonel Feininger, den die Kuratoren ziehen, wird in der räumlichen Inszenierung nachvollziehbar. Eliasbergs Meisterschülerzeit bei Roger Bissière an der Académie Ranson von 1928 bis 1930 prägte seinen zeichnerischen, die Linie betonenden Stil nachhaltig. Die Anklänge an Piranesis verschachtelte Carceri d’Invenzione gewinnen im architektonischen Kontext des Museums zusätzliche Bedeutungsebenen.
Braunschweig als Museumsstandort: Stärken und Herausforderungen
Die parallele Kabinettausstellung zu Bodo Kampmann verdeutlicht die regionale Verankerung des Museums. Kampmanns Skulpturen prägen das Braunschweiger Stadtbild nachhaltig – vom Rufer an der Magnikirche bis zur Justitia am Landgerichtsgebäude. Die Schenkung seiner Tochter Karoline Kampmann erweitert die museale Sammlung um wichtige Facetten des Goldschmiedehandwerks.
Diese Verbindung von internationalem Anspruch (Eliasberg) und regionaler Identität (Kampmann) charakterisiert die Programmstrategie des Hauses treffend. In Zeiten knapper kommunaler Kassen und zunehmender Konkurrenz um Publikumsgunst positioniert sich das Städtische Museum klug zwischen lokaler Verwurzelung und überregionaler Ausstrahlung.
Fazit: Mehr als nur ein Museum
Das Städtische Museum Braunschweig beweist mit der Eliasberg-Ausstellung, dass regionale Museen keine Provinzialität bedeuten müssen. Die Verbindung von herausragender historischer Architektur, qualitätvoller Sammlung und innovativer Vermittlungsarbeit schafft ein kulturelles Gravitationszentrum, das weit über die Stadtgrenzen hinaus wirkt. Wenn Paul Eliasbergs verzauberte Räume auf Max Osterlohs architektonische Vision treffen, entsteht ein Gesamtkunstwerk, das die Besucher noch bis zum 5. Oktober 2025 in seinen Bann ziehen wird.
Die sorgfältige Restaurierung des Jugendstilbaus und seine zeitgemäße technische Ausstattung zeigen, wie denkmalgeschützte Museumsarchitektur im 21. Jahrhundert funktionieren kann: als lebendiger Ort der Begegnung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen regionaler Tradition und internationaler Moderne. Das Haus am Löwenwall ist damit nicht nur Ausstellungsort, sondern selbst Exponat – ein Architekturdenkmal, das seine eigene Geschichte erzählt und gleichzeitig Raum für neue Narrative schafft.

Berufspolitisches Versagen? Die Baubranche zwischen Regulierung und Realität

„Das war obszön” – Insider packen über Benkos geheimes Millionen-Penthouse aus